| Home |
||
| Zeichenerklärung: |
||
| Leseprobe... | |||
| Monika Pan-Stadler
"Wir aber wollen über Grenzen sprechen" Zur kulturwissenschaftlichen Dimension im Werk Ingeborg Bachmanns |
3.1 Kritik der instrumentellen Vernunft 3.1.1 Wissen und Wahrheit [...] Die Wahrheit aber ist keine "alte solide Kommode", wie der Richter Wildermuth in der gleichnamigen Erzählung (Ein Wildermuth) feststellen muss, da selbst "die Wahrheit über einen Knopf [...] nicht so leicht herauszubekommen" ist "bei dem Stand der Wissenschaft". [1] [...] Und Wildermuth legt seine Richterrobe ab, um die Welt abzutasten, "bis mir die Wahrheit wird über das Gras und den Regen und über uns: ein stummes Innewerden, zum Schreien nötigend". Zwischen Stummheit und Schrei, näher am Märchen als an der Wissenschaft, nahe am Körper und den Einprägungen im Gehirn, erfolgt die Wahrheitssuche in Bachmanns Text. Das Grenzthema ist funktionell dazu, so an der intermedialen Grenze, wenn "Dichtung und Musik den Augenblick der Wahrheit miteinander haben" weil "eine Spur von der einen zur anderen Kunst führt", oder an den Figurengrenzen: "das ganze Buch ist angelegt auf die Gewinnung der Figur von Malina, die objektiv und souverän ist, während Ich subjektiv und unbrauchbar war. Dadurch fällt später jede fragwürdige Erzählperspektive weg [...], weil Malina alles weiß und frei über alle Figuren verfügt". [...] [2] Für Bachmann ist Erzählen eine Fortsetzung der Recherche jenseits der Grenzen von Philosophie und Wissenschaft. "Wo Heidegger zu philosophieren beginnt, hört Wittgenstein zu philosophieren auf", formuliert sie im Wittgenstein-Essay und Weigel ergänzt: "dort fängt Bachmann zu schreiben an - so könnte man den Satz fortsetzen [...], tatsächlich ist das Ende der Philosophie als Wissenschaft für Bachmann der Anfang des anderen Schreibens, [...] das [...] jene Grenze überschritten hat, die im 'Tractatus' gezogen wird." Wie kann sich aber nun das Schreiben, besser als Philosophie und Wissenschaft, in ein Einvernehmen mit seinem Gegenstand setzen, das nicht nur den "Schatten des Todes" zurücklässt? Im Proust-Essay spricht Bachmann, mit einem Curtius-Zitat, von einer kontemplativen "Haltung, die eine reale Verbindung zwischen Sehendem und Gesehenem herstellt". Es geht darum, objektivierendes Sprechen zu vermeiden ("nicht reden 'über', damit dem Geschwätz nicht noch ein Geschwätz hinzugefügt wird"), sondern um ein wechselseitiges Erkennen, um "Einklang", Respekt und die "erste Pflicht", das "Menschenrecht" der Übersetzung: "jeder muß den andren ein wenig übersetzen", weil Denken, Fühlen, Sprechen "sich nie ganz begegnen", wie es in den poetologischen Entwürfen zum Simultan-Band heißt. Es ist eine grenzüberschreitende, aber nicht profanierende, dialogische und mitteilende Form des Gesprächs, denn "jeder stirbt doch an den anderen [...]. Ebenso wie jeder auflebt am anderen". 3.1.2 Ambivalenz der Psychoanalyse Hans Höller sieht Bachmanns Texte als "Organon einer aktuellen kritischen Kulturwissenschaft [...] im rettenden Eingedenken der sprachanalytischen und psychoanalytischen Moderne." Tatsächlich gibt es gewisse wissenschaftliche Disziplinen, die in Bachmanns Texten thematisiert werden, wobei die Psychoanalyse als Leitwissenschaft erscheinen könnte, der Archäologie und Geologie metaphorisch zugeordnet sind. In einem Interview mit Toni Kienlechner erwog Bachmann offenbar, von Rom nach Wien zurückzukehren, "um sich dort als Psychoanalytikerin niederzulassen", und in der Zeit der Krankheit unterzog sie sich selbst einer analytischen Behandlung. Das hindert sie aber nicht an schärfster Kritik einer bestimmten Praxis der Psychoanalyse gegenüber. Für die Dishumanisierung des anderen im Namen der Wissenschaft findet sie vor allem im Franza-Roman sehr harte Worte, und der Analytiker Jordan ist trotz seines Erfolgs nicht nur ein verbrecherischer, sondern auch ein zweifelhafter Arzt, der seine Intelligenz missbraucht und offensichtlich selber Störungen aufweist: "er muß ja krank sein, ich bin nur davon krank geworden", formuliert Franza in ihrer kulturkritischen Abrechnung mit den Weißen, die ihre "Intelligenz [...] mißbrauchen". [3] |
||
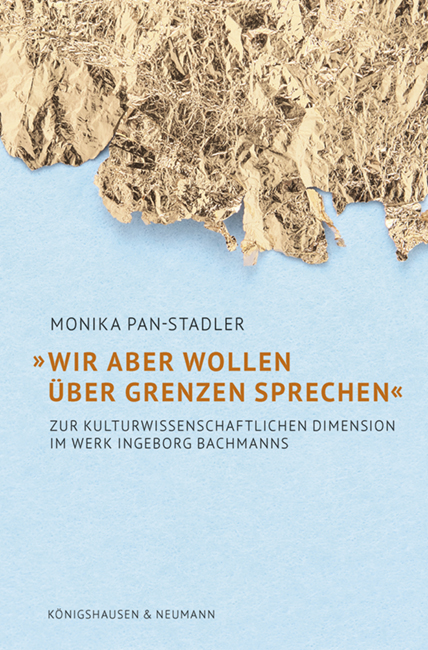 |
|||
| Königshausen & Neumann Würzburg 2024 |
|||
| Information zu dieser Seite: | Zeichenerklärung: |
|
| Leseprobe aus dem Kapitel 3 "Weiß man es wirklich?. Man weiß doch gar nichts!" in: Monika Pan-Stadler: "Wir aber wollen über Grenzen sprechen". Zur kulturwissenschaftlichen Dimension im Werk Ingeborg Bachmanns. Königshausen & Neumann, Würzburg 2024, S. 51 - 53. |
||
| [1] | Zitiert wird "Ein Wildermuth" aus der von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum, Clemens Münster herausgegebenen Werkausgabe, München/Zürich 2010, Bd. 4, S. 340. | |
| [2] | Ingeborg Bachmann "Todesarten-Projekt", bearbeitet von Monika Albrecht und Dirk Göttsche, Müchen/Zürich 1995, Bd. 3.2, S. 740. | |
| [3] | Bezug genommen wird auf das 3. Kapitel "Die ägyptische Finsternis" im (unvollendeten) Roman "Der Fall Franza" (Werkausgabe, s. Fussnote [1]), Bd.3, S. 466 und S. 438. | |
| Ich danke der Autorin und dem © Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg für die freundliche Genehmigung zur Publikation | ||
| © Ricarda Berg, erstellt:
Juli 2025, letzte Änderung: 22.09.2025 http://www.ingeborg-bachmann-forum.de - E-Mail: Ricarda Berg |
||
| Home | Ingeborg Bachmann Forum | Leseproben (Index) | Kleine Bibliothek | Bibliographie | Top | |